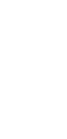摘要
在此期间,皮肤病学在自然科学中寻找并找到了合作伙伴,并将自己融入其中。4 德国的统一也发生在这一时期的欧洲大陆中心;随后苏联的解体承诺了一个新的欧洲,并意味着公民社会的新意识。皮肤现在被视为人体最大的器官,是人与环境之间的重要接触面,也是一个引人注目的器官,实际上是人的名片。对于德国的皮肤科医生来说,这是一个启蒙的时代,是一个对自然科学敏感的时代;当时年轻一代的座右铭是:更多知识、更多能力、更多业绩。位于当时西柏林的施特格利茨诊所是德国第一家按照美国模式运作的大型诊所,其团队代表并推广了皮肤病学研究模式。它是维利-勃兰特和美国国务卿的妹妹埃莉诺-杜勒斯(Eleanor Dulles)的杰作,当时人们常称她为 "柏林母亲"。5 1967 年在慕尼黑召开的第一届世界大会首次宣告了该学科在德国的新纪元,20 年后,即 1987 年,在当时处于分裂状态的西柏林召开的第二届大会向全世界广大公众展示了这一新纪元。柏林大会让人们看到了德国皮肤病学重新恢复的效率,柏林成为东西方之间的桥梁。6 因此,柏林基金会诞生于上世纪最后二三十年的时代精神变革之中。6 柏林皮肤病学基金会 (BSD) 今年正值成立 25 周年,但它并不是一个私人基金会。6 柏林皮肤病学基金会(BSD)今年正值成立 25 周年,它并不是一个私人基金会,而是上世纪最后十年在柏林自由大学内成立的,是上世纪八十年代学科新方向时代的产物。当时,京特-施特根(Günter Stüttgen)和我满怀信心地认为,这是服务于该学科的正确方式。基金会最初从上届柏林世界大会的收益中获得了一百万马克的资本;加上新货币发行后的捐赠和最初的捐款,基金会的资本总额约为 70 万欧元。这笔资金被用于促进皮肤病学的发展,每年组织多次科学研讨会,并向一些经过挑选的年轻同行颁发了高额科学奖。迄今为止,已有来自 23 个国家的 36 名年轻同事获得了奖学金。在冠状病毒大流行期间,基金会的活动不得不暂停数年;2019 年至 2023 年期间不再颁发科学奖,也无法举办现场活动。7 柏林基金会利用利息和复利,总共资助了 100 多名临床培训、研究项目、设备、书籍、奖学金和大会参与等方面的受助者,资助总额约为 30 万欧元,没有花费太多官僚机构的精力。医学界的重要代表、基础科学家和著名律师都曾做过客座演讲。甚至连诺贝尔医学奖得主哈拉尔德-祖尔-豪森(Harald zur Hausen)这样的名人也参加了基金会的座谈会并发表了演讲。基金会在国外开展的众多活动在此难以一一列举:有东欧奖学金、非洲奖学金、奖金、BFD 穷人基金、与埃及开罗军事学院联合建立现代皮肤病病理学等等。所有这些都是基金会为学科利益而持续成功开展工作的 "活贡献"。过去那个变革时代的氛围在今天几乎不复存在,社会背景下的视角已经发生了变化。今天的医学正在向新时代过渡,向数字技术医学过渡,就像皮肤病学一样。但这恰恰是当今医学界应当建立和支持基金会的一个重要原因。Die Berliner Stiftung für Dermatologie hat in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem wissenschaftlichen Symposion in Berlin gefeiert.
Als wir vor über 30 Jahren mit Günther Stüttgen die Vision hatten, eine Stiftung für Dermatologie in Berlin zu gründen, war die Dermatologie in einer besonderen Phase ihrer Entwicklung, inzwischen hat sich in der Gesellschaft vieles gewandelt, so auch in unserem Fach und dieser Wandel berührt in hohem Maße auch die Stiftung.
Die Geschichte der deutschen Dermatologie ist lang,1, 2 nicht zuletzt jene der über 100-jährigen Berliner Schule.3 Im vorliegenden Beitrag wird sie kurz angeführt werden, die Gründung der Stiftung in einer besonderen Epoche des Faches wird herausgestellt und ihre bisherige Tätigkeit wird kurz erläutert.
Die Gründung deutschsprachiger Universitäten im frühen 19. Jahrhundert hatte eine humanistische Bildung zum Ziel, als Ausdruck von Gelehrsamkeit im wachsenden Bewusstsein des deutschen Idealismus. Gleichzeitig sollte man Lehraufgaben wahrnehmen und eine Einheit von „Lehre und Forschung“ herstellen. Denken und Forschen lagen damals auch in den medizinischen Fakultäten nahe, eine naturwissenschaftliche Forschung war allerdings noch in ihrer ersten Entwicklung und stand fern einer gezielt praktischen Umsetzung des Wissens.
Die Medizin war insgesamt ein Sonderfall. Vorherrschend sah man die Behandlung des kranken Menschen als soziale Mission, wie es von Rudolph Virchow (1821–1902) formuliert wurde, und diese wäre im Interesse der Bürger eine Aufgabe des Staates. Private Stiftungen waren nicht üblich, vielmehr stifteten der Staat oder die Kirchen ein Krankenhaus zum Wohle der Bevölkerung. Bildung mit humanistischem Charakter im Sinne des iatrosophos von Galen stand seinerzeit für den angehenden Arzt im Vordergrund. Dementsprechend war für das Medizinstudium zunächst ein vorbereitendes Philosophikum vorgegeben. Erst 1861 wurde dies in einer Reform aufgegeben und die Vorgabe eines Physikums für die Studenten der Medizin eingeführt. Damit wurde erstmals in Deutschland im Medizinstudium naturwissenschaftliches Wissen als Basis für die Klinik vorgeschaltet, wenn auch weiterhin die klinische Erfahrung galt.
Die Dermatovenerologie wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts als gesondertes klinisches Fach in Europa herausgestellt und zwei Generationen von namhaften Ärzten befassten sich mit den Krankheiten der Haut. Ihre Zahl hatte auf dem europäischen Kontinent seit Beginn des Jahrhunderts durch Urbanisierung, Industrialisierung und Militäreinsätzen stark zugenommen. Die krankhaften Läsionen von Haut und Schleimhaut wurden deskriptiv beschrieben, entsprechend benannt und äußerlich symptomatisch behandelt. Dabei spielten die Wiener und die Berliner Schulen eine herausragende Rolle bei der Entstehung einer neuzeitlichen Dermatologie.3
Auf die nachfolgende Generation um die Jahrhundertwende gehen die ersten Versuche in Richtung einer klinischen Forschung mit Hilfe verbesserter Mikroskope zurück, etwa in Histologie, Mykologie und vor allem in Bakteriologie. Namhafte Fachvertreter haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine morphologisch orientierte, deutschsprachige Dermatologie etabliert, die eine führende Position in Europa einnahm (Tabelle 1).
Im 20. Jahrhundert kam es während der Nachkriegszeit zu einem Umbruch. Herausragende Fachvertreter des Faches in den USA wie beispielsweise R. Baer, M. Sulzberger, W.F. Lever, H. Pinkus, T. Fitzpatrick, A.M. Kligman, E. Farber, mehrere davon deutscher Herkunft, und andere in Europa, wie etwa Darrell Wilkinson und Stephanie Jablonska, haben nach dem Zweiten Weltkrieg den Aufbau der Dermatologie in Deutschland nachhaltig unterstützt. Der internationale Austausch blühte, jüngere deutsche Dermatologen wurden fortgebildet und mit neuem Gedankengut befruchtet. So haben sie sich einer neuen investigativen Ausrichtung des Faches angepasst und wichtige Beiträge darin geleistet.
Die deutsche Dermatologie hat vom wissenschaftlichen und akademischen Austausch mit dem Westen während der letzten Nachkriegszeit stark profitiert. Sie wurde bereichert und befruchtet. Neue Wissenschaftsgebiete, neue Forschungsfelder und Techniken wurden eingeführt und machten die Dermatologie attraktiv. Das neue Modell veränderte gründlich das Gesicht des Faches, eine neue Epoche brach an; das Hautorgan wurde eine Fundgrube für medizinische Forschung. Hautkliniken mit guter technischer Ausstattung wurden in Deutschland neu gebaut, Laboratorien wurden angeschlossen, neben der klinischen Diagnostik betrieb man Forschung. Lehrstühle wurden in den 70er und 80er Jahren zunehmend mit forschungsorientierten, jüngeren Ärzten besetzt.
Somit kennzeichneten die letzten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts den Übergang von einer traditionellen morphologischen zu einer investigativen Dermatologie. Eine neue Epoche brach an für das Fach, das auch in den Fakultäten eine bedeutende Position einnahm. Die Dermatologie hatte sich inzwischen in den Naturwissenschaften einen Partner gesucht und gefunden, und sich darin integriert.4 Im Zentrum des Kontinents fand auch die Wiedervereinigung Deutschlands während dieser Zeit statt; der nachfolgende Zusammenbruch der Sowjetunion versprach ein neues Europa und bedeutete ein neues Bewusstsein für die Zivilgesellschaft.
In dieser Epoche, mit dem Willen zum Neuen und Besseren, entstand eine neue investigative Dermatologie, die dem Zeitgeist entsprach. Die Haut wurde nun als größtes Organ des Körpers wahrgenommen, als wichtige Kontaktfläche des Menschen mit seiner Umwelt, als Vorzeige-Organ, praktisch als seine Visitenkarte. Für die Dermatologen Deutschlands wurde es eine Zeit der Aufklärung, der Empfindsamkeit den Naturwissenschaften gegenüber, das damalige Motto der jungen Generation war: Mehr Wissen, mehr Können, mehr leisten. Es war wie ein Gewitter.
Das Klinikum Steglitz im damaligen West-Berlin war in Deutschland das erste Großklinikum das nach amerikanischem Muster funktionierte, mit einer Mannschaft, die das Model der investigativen Dermatologie vertrat und förderte. Es war ein Vorzeigeobjekt von Willy Brandt und Eleanor Dulles, die Schwester des US-Außenministers, die „Mutter Berlin“ wie man sie damals oft nannte. Hauptakteure bei diesem Umbruch waren Arbeitsgruppen um mehrere Fachvertreter, insbesondere von O. Braun-Falco in München, G. K. Steigleder in Köln, E. Macher in Münster, G. Stüttgen wie auch unsere eigene Gruppe in Berlin.5
Die neue Epoche das Faches in Deutschland wurde mit einem ersten Weltkongress 1967 in München erst angekündigt und 20 Jahre später, 1987, mit einem zweiten im damals geteilten West-Berlin einer sehr breiten Öffentlichkeit weltweit präsentiert. Der Berliner Kongress hat die wiedererlangte Leistungsfähigkeit der deutschen Dermatologie sichtbar gemacht, mit Berlin als Brücke zwischen Ost und West. Sie wurde international begrüßt und gefeiert, war die Bestätigung des neuen Aufbruchs der deutschen Dermatologie in Richtung Forschung, Vernetzung und internationaler Kooperation.6 Geburtshelfer der Berliner Stiftung war somit der Wandel im Zeitgeist während der letzten zwei bis drei Dekaden des vergangenen Jahrhunderts.
Die Berliner Stiftung für Dermatologie (BSD) die in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum feiert ist keine private Stiftung. Sie wurde während der letzten Dekade des vergangenen Jahrhunderts innerhalb der Freien Universität Berlin gegründet als Kind der Epoche der neuen Orientierung des Faches in den 80er Jahren. Günter Stüttgen und ich waren seinerzeit voller Zuversicht, dass dies der richtige Weg war, um dem Fach zu dienen.
Die Stiftung wurde anfangs mit einem Kapital von einer Million DM aus den Einnahmen des letzten Berliner Weltkongresses ausgestattet, mit Zustiftungen und anfänglichen Spenden nach der Einführung der neuen Währung betrug das Stiftungskapital etwa 700 000 Euro. Damit wurde die Dermatologie gefördert, zahlreiche wissenschaftliche Jahressymposien wurden durchgeführt und eine Reihe ausgewählter jüngerer Kollegen mit einem hochdotierten Wissenschaftlichen Preis ausgezeichnet.7, 8 Mehrere BSD-Preisträger wurden später auf Lehrstühle berufen. Bis einschließlich heute wurden Stipendien an 36 jüngere Kollegen und Kolleginnen aus 23 Ländern vergeben. Während der Corona-Pandemie musste die Tätigkeit der Stiftung über mehrere Jahre ruhen, 2019 bis 2023 wurden keine wissenschaftliche Preise mehr verliehen, Präsenz-Veranstaltungen waren nicht möglich.
Insgesamt konnte die Berliner Stiftung mit Hilfe von Zinsen und Zinseszinsen über 100 Förderungsempfänger für klinische Fortbildung, Forschungsprojekte, Apparate, Bücher, Stipendien und Kongressteilnahmen unterstützen, wobei eine Gesamtfördersumme von ca. 300 000 Euro ohne viel bürokratischem Aufwand vergeben wurde. Wichtige Vertreter der Medizin, Grundwissenschaftler und prominente Juristen Gastvorträge gehalten. Selbst Koryphäen, wie der Nobelpreisträger für Medizin Harald zur Hausen haben bei den Stiftungssymposien teilgenommen und vorgetragen.
Es ist kaum möglich, die zahlreichen Stiftungsaktivitäten im Ausland hier einzeln anzuführen; es waren Osteuropa-Stipendien, Afrika-Stipendien, Preise, BFD-Funds for the Poor, die Etablierung einer modernen Dermatohistopathologie in Verbindung mit der Militärakademie in Kairo, Ägypten, und manches andere. All das war ein „gelebter Beitrag“ zum weiteren Erfolg der Stiftungstätigkeit im Interesse des Faches.
In der Neuzeit haben diverse Turbulenzen die Geisteshaltung, die zu einer Stiftungstätigkeit gehört bisher nicht gefördert. Die Stimmung der vergangenen Aufbruchsepoche ist heute kaum noch präsent, die Perspektiven wurden in gesellschaftlichen Kontext verändert. Die heutige Medizin ist dabei, in eine neue Epoche überzugehen, in eine digitale Techno-Medizin, ebenso wie die Dermatologie. Doch dies ist gerade ein wichtiger Grund, warum man heute gerade in der Medizin Stiftungen gründen und unterstützen sollte.
Mit der offensichtlichen Veränderung des Zeitgeistes setzt sich in Deutschland im 21. Jahrhundert eine neue Ära im Gesundheitswesen schrittweise durch. Der Bedarf an Stiftungstätigkeit ist weiterhin präsent, der Spenden- und Stiftungsgedanke scheint immer noch notwendig, ist vielleicht sogar noch dringender geworden. Bei dem grassierenden Hightech-Enthusiasmus und der zunehmenden Industrialisierung und Kommerzialisierung wird es für Stiftungsaktivitäten in der Medizin künftig sicher nicht leicht, es könnte ein mühsamer Weg werden. In neueren verhaltensökonomischen Experimenten hat sich aber gezeigt, dass der reale Mensch in seinem Streben nach Glück weder zur perfekten Rationalität neigt, noch durchgängig eigennützig handelt. Er strebt nicht nach Maximierung seines Nutzens, er leidet unter Verlusten mehr als ihm Gewinne Freude bringen. Und die Tätigkeit in einer Stiftung bringt definitiv Freude, mitunter Glück.
So ist der neuen Geschäftsführung der Berliner Stiftung im Interesse unseres Faches ein guter neuer Anfang und viel Erfolg für die Zukunft zu wünschen.

 求助内容:
求助内容: 应助结果提醒方式:
应助结果提醒方式: